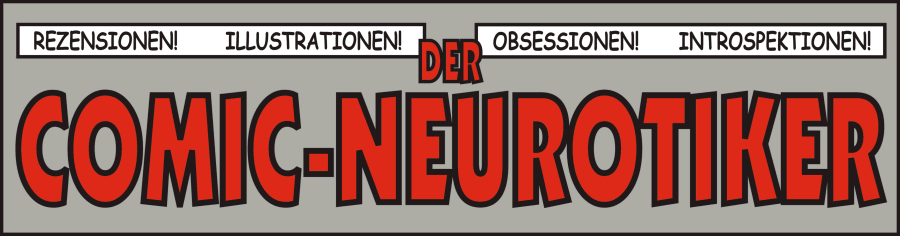(März 2009)
- Ein geöffnetes Päckchen unverschnittenen Heroins, aus kurzer Entfernung ins Gesicht geschleudert, setzt einen bewaffneten Angreifer in Sekundenbruchteilen außer Gefecht. Brubaker/Phillips: Criminal [Vol. 1] – Coward, Icon/Marvel 2007
- Wurden den Opfern eines Serienmörders Gesäßbacken, Leber, Wangen und/oder Zunge entfernt, so handelt es sich beim Täter mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Kannibalen. Ōtsuka/Tajima: MPD – Psycho [Vol. 1], Dark Horse 2007
- Harold Ross, der 1925 mit "The New Yorker" das wohl bekannteste Magazin für Literatur und literarischen Journalismus gründete, war berüchtigt für seine Unbelesenheit. So brüllte er einmal beim Redigieren eines Artikels in die Redaktion:
"Moby Dick – der Mann oder der Wal?"
Seth: It's a Good Life If You Don't Weaken, Drawn & Quarterly 1996
Herr Linskgolfer (der übrigens glaubhaft versichert, er sei nicht der Golfexperte der "Jungle World") mailte mir heute diese – abgesehen von der schlimmen falschen Glatze – bislang schönste Satire zur Krise.
Zu Zack Snyders Film "Watchmen – Die Wächter"
"Stood in firelight,
swelterig bloodstain on chest
like map of violent new continent.“
Alan Moore/Dave Gibbons:
"Watchmen"
"I was closing in on this dope dealer
and I needed to take a leak.
By the time I'd got in and out of my costume,
he'd vanished.“
Alan Moore/Dave Gibbons:
"Watchmen"

Superheld Rorschach (Jackie Earle Haley) leuchtet
schlechten Comic-Verfilmern heim.
"Weil er da ist."
George Mallorys berühmte Reaktion auf die Frage, warum er denn unbedingt den Mount Everest erklimmen wolle, eignet sich auch als Antwort auf die Frage, warum Zack Snyders "Watchmen"-Film denn so großartig sei.
Nach all den verworfenen Konzepten, gescheiterten Finanzierungen und gefeuerten Regisseuren, nach all den furchtbaren bis halbgaren anderen Alan-Moore-Adaptionen, nach all dem Prozesstheater zwischen dem "Watchmen"-Verleih Warner Bros. und dem Alt-Rechteinhaber Fox: Wer sich auch nur ein bisschen für Comic oder Kino interessiert, dürfte zumindest ansatzweise mit all diesem Elend vertraut sein.
Und dann sitzt man im Kino und kneift sich, denn "Watchmen" ist ein absolut surreales Erlebnis.
Nicht, weil der Film von einer Welt erzählt, in der Superhelden mehr oder weniger alltäglich sind. Nicht, weil er in den aus heutiger Sicht ohnehin surrealen 80ern spielt, inklusive eines drohenden Atomkriegs zwischen USA und UdSSR. Nicht, weil hier dreizehn Jahre nach Watergate immer noch Richard Nixon das Weiße Haus besetzt hält, nachdem er dank Superhelden-Power in Vietnam gesiegt und einfach mal die Verfassung geändert hat. Und auch nicht, weil Nixon im Film mit einem Zinken wie Pinocchio herumläuft.
Nein, sondern weil eine adäquate filmische Adaption des Jahrhundert-Comics von Alan Moore und Dave Gibbons so lange ökonomisch und künstlerisch unmöglich schien. Und weil Zack Synders Film deshalb wirkt, als sei er aus einer anderen Dimension gefallen: einer Welt in der Comics zum Bildungs-Kanon gehören und in der niemand die Stirn runzelt, wenn sie sich mit kompliziertesten philosophischen Fragen befassen.
"Watchmen" ist die erste ernstzunehmende Alan-Moore-Verfilmung und zugleich der erste Film, der Alan Moore ernst nimmt. A priori erklärt Snyder hier jeden Kritiker zum Idioten, der behauptet, der Film erhebe sich über seine Vorlage. Zugegeben: Das hat Robert Rodriguez mit "Sin City" auch getan, allerdings ist "Watchmen" sehr viel mehr als ein style-besoffenes Sex-und-Gewalt-Märchen (not that there's anything wrong with that). Im Kern geht es hier um eine erstmals im antiken Griechenland gestellte Frage: Wenn allmächtige Wächter über das Recht wachen, wer überwacht dann die allmächtigen Wächter? Obwohl Snyders Film sechzehn Jahre vor 9/11 spielt, lässt er sich leicht als Kommentar zum "War on Terror" lesen.
Nun ist Mr. Snyders Adaption keinesweg perfekt. Zwei große Probleme trüben die Freude an dieser insgesamt gelungenen Umsetzung. Da ist zum einen die – pardon – Gewaltgeilheit. Snyder erlangte 2004 ersten Ruhm als Regisseur des gelungenen "Dawn of the Dead"-Remakes (ich kann mich gut daran erinnern, wie ich den Film in einem Londoner Kino sah und nach der pre title sequence mein Herz schlagen spürte ). Anschließend schuf Snyder mit der Verfilmung von Frank Millers ästhetisch durchaus bemerkenswertem Comic "300" einen Megahit – der aber leider aus Millers spartanisch-lakonischer Vorlage ein opulentes Schlachtfest machte, mit bescheuerten Monstern und einer noch bescheuerteren Sandalenfilm-Nebenhandlung.
Bei "Watchmen" verhindert Alan Moores umfangreiches und komplexes Szenario, aber auch die Oscar-würdige Finesse der Drehbuchautoren David Hayter ("X-Men 1 + 2") und Alex Tse solchen Unfug: Hier galt es zu kürzen, nicht auszuschmücken. Dennoch hatte Snyder offenbar immer noch seine blutrünstigen Spartaner im Hinterkopf. Zwar geht es in Ordnung, dass er die Superhelden mit übermenschlicher Wut und Wucht kämpfen lässt, statt sie wie Moore fast nur verbal streiten zu lassen. Auch dass er die Brutalität des Comic-Gefängnisaufstands auf Splatterfilm-Niveau hochschraubt, ist legitim: Diese Szenen funktionieren tatsächlich besser als in der Vorlage. Problematisch wird es aber, wenn sich die Kamera an einer coolen Keilerei mit Straßenräubern ebenso delektiert wie an der Ermordung des Comedian und der Vergewaltigung von Silk Spectre I. – oder soll genau diese stilistische Gleichsetzung nachdenklich stimmen? Sie tut es in jedem Fall.
Das zweite große Problem ist zugleich die größte Qualität dieser Comic-Verfilmung: Die Macher nähern sich der Vorlage, wie sich Gläubige einem religiösen Urtext nähern. Beim Drehbuch funktioniert das fabelhaft: Hayter und Tse entfernen Nebenhandlungen mit viel Feingefühl und hinterlassen kein taubes Gewebe. Und natürlich zeugt es von Chuzpe, dass Snyder gegenüber den Bedenkenträgern des Studios darauf bestand, immer wieder den blauen Schniedel des Übermenschen Dr. Manhattan zu zeigen, dass die Helden Rorschach und Comedian noch psychotischer und gefährlicher wirken als im Comic (auch wenn Rorschachs latenter Frauenhass eliminiert wurde) und dass der Regisseur von vornherein auf eine kommerziell mutige Ab-18-Freigabe hinarbeitete.
Oft allerdings laden die durchgestylten, sinnschweren Bilder zum Verweilen ein, statt sich in den Fluss des Films zu fügen. Und: Beim Ensemble scheint Snyder zu viel Überzeugungsarbeit geleistet zu haben, denn seine Darsteller tragen streckenweise schwer, allzu schwer unter der literaturhistorischen Last der Vorlage. Speziell Malin Ackerman als Silk Spectre II., Patrick Wilson als Nite Owl II. und die von mir ansonsten sehr geschätzte "Spy Kids"-Mama Carla Gugino als Silk Spectre I. schauspielern mitunter arg.
Hier fällt "Watchmen" tatsächlich hinter die willkommene milde Selbstironie von "Iron Man" oder "Spider-Man" zurück und erst recht hinter den klugen Sarkasmus von Moores Szenario. Dass die Darsteller nicht stärker mit ihren Rollen verschmelzen, ist um so bedauerlicher, als Snyder bewusst nur TV- und Kino-Akteure aus der zweiten Reihe besetzt hat, damit keine bekannten Gesichter von der Geschichte ablenken.
Unabhängig von der Bekanntheit ihres Namens oder Gesichts schlagen sich einige Darsteller aber durchaus gut: Billy Crudup ("Almost Famous") als entrückter CGI-Nackedei Dr. Manhattan, Jackie Earle Haley ("Little Children") als rotsehender Schwarz-Weiß-Maskenmann Rorschach, Matthew Goode ("Matchpoint") als femininer, hyperintelligenter Ozymandias (eine Art Superhelden-Oscar-Wilde – im Film, nicht im Comic) und vor allem Serienstar Jeffrey Dean Morgan ("Grey's Anatomy", "Weeds") als charismatisches Schwein Comedian.
Am besten funktioniert "Watchmen" dort, wo Snyder das Filmische der Vorlage in pures Kino umsetzt. Zentrales Bild des Films ist die Tintenklecks-Maske des Selbstjustiz-Freaks Rorschach: die scharf voneinander abgegrenzten Schwarz-und-Weiß-Flächen, die sich aber ständig wandeln und verschieben. Moore und Gibbons' geniales Sinnbild für moralische Ambivalenz hat geradezu auf sein Kinodebüt gewartet, nun endlich darf es sich und uns bewegen.
Kinetische Kraft entlockt Snyder auch Moores Motiv des Uhrwerks: Du magst die Welt zerstören und neu zusammensetzen, letztlich läuft höchstwahrscheinlich doch wieder alles in alten Bahnen.
Die größte Freiheit nimmt sich der Film bei den legendären Meta-Aspekten der Vorlage heraus: Die fingierten Auszüge aus dem "klassischen" Piraten-Comic "Tales of the Black Freighter" fehlen komplett. Eine verständliche Entscheidung, denn diese Ebene hätte Snyders ohnehin forderndes Zweieinhalb-Stunden-Epos jeglicher Chancen an der Kinokasse beraubt.
Auch das in Nerd-Kreisen ja längst heiß diskutierte veränderte Finale ergibt Sinn. Das Original-Ende war visuell deutlich wuchtiger und verstörender, allerdings auch stark in den Meta-Pulp-Kontext von Moores Szenario eingebunden – und hätte deshalb im Kino bestenfalls halb so gut schockiert, schlimmstenfalls für Erheiterung gesorgt. (Auf DVD sollen die "Black Freighter"-Szenen wieder in die Handlung integriert werden – eine Idee, die vielleicht besser klingt, als sie ist.)
Statt dessen erschafft der Film nun seine eigene, weit weniger ausgefeilte, aber sehr unterhaltsame Meta-Ebene. Etwa durch eine hinreißende Parodie auf das legendäre Victory-Day-Kuss-Foto oder eine bösartige Randnotiz zum Kennedy-Attentat. Mit subversivem Biss führen Snyder & Co. hier die Manipulierbarkeit von "Historie" vor. Zugleich spielt der Film dabei ironisch auf Alan Moores ethische Frage an, ob es eine "gute" Manipulation geben kann.
"Watchmen"-Autor Moore erklärte ja bereits vor Monaten, dass ihn Zack Snyders Adaption einen feuchten Kehricht interessiere. Dabei könnte Moore eigentlich zufrieden sein. Nicht unbedingt mit dem Film, aber mit dem, was er selbst 1986 angestoßen hat und was sich nun im Kino manifestiert. Hey, wenn Hollywood-Geldsäcke und Ex-Werbefilmer lernen können, dass manche Comics ganz große Kunst sind, dann kann es doch eigentlich jeder kapieren, oder?
Hoffen wir, dass das Ding nicht floppt.
[Zu Platz 2]

(© 2006 Shaun Tan;
Dt. Ausgabe: © 2008 Carlsen)
Die Begeisterung, die sein Buch international ausgelöst habe, überrasche ihn doch sehr, sagt Shaun Tan. Fern seiner Heimat Australien hat es ihm Anfang 2008 auf dem Comic-Festival von Angoulême den Preis für das Beste Album eingebracht (quasi die Goldene Palme der Comic-Welt). In Amerika öffnete es ihm die Tür zum Trickstudio Pixar, wo er Müll-Landschaften für das Robotermärchen "Wall-E" entwarf.
"Ich bin immer davon ausgegangen, dass man 'Ein neues Land' als eine Art Kuriosität betrachtet, die angesichts der unkonventionellen Form erst nach einer Weile ihr Publikum finden würde." Vielleicht übte Tan sich in seinem Interview mit dem "Comics Journal" ja in Bescheidenheit. Vielleicht sagte er auch einfach die Wahrheit. Denn "Ein neues Land", in Australien 2006 als "The Arrival" erschienen, ist sicher eine der ungewöhnlichsten Graphic Novels.
Tan setzt sich mit seinem Werk zwischen alle Stühle – und schwebt! "Ein neues Land" ist ein Bilderbuch, aber nichts für kleine Kinder. Es ist eine Utopie, die vom Gestern erzählt. Es ist Avantgarde mit nostalgischer Anmutung. Cover und Anordnung der Panels imitieren ein altes Fotoalbum, die Bilder und Bildfolgen selbst zitieren den Stummfilm, hinter dem Fotorealismus der Gesichter verbergen sich feinste Bleistiftschaffuren.
Was "Ein neues Land" vielleicht nicht ist: ein Comic. Jedenfalls nicht, wenn man Sprechblasen als unabdingbaren Teil der Definition betrachtet. Die Geschichte teilt sich gänzlich ohne Worte mit, durch Gesten und Mimik, Bildaufbau und Montage. Mitunter überlässt Tan es aber auch dem Leser, sich in einem riesigen Wimmelbild voll verwirrender Formen allein zu orientieren und so die Fremdheitserfahrung des Helden nachzuvollziehen. Gleichwohl bilden Sprache und Schrift, ihre trennende und verbindende, ihre wahrnehmungsprägende und sinnschaffende Funktion das Hauptthema des Buches. Es wimmelt nur so von Schriftzeichen – allerdings entstammen sie keiner bekannten Sprache. Sie wirken so fremd wie die Flugbusse, Kringelpflanzen und Vogelfische dieser neuen Welt.
Wie schon bei Platz 3 dieser Liste warne ich lieber vor: Wer "Ein neues Land" für sich allein entdecken will, sollte jetzt erst einmal das Buch lesen. Wie bei allen wahren Meisterwerken bereitet es auch hier bei der ersten Lektüre um so mehr Vergnügen, je weniger man weiß, und bei jeder weiteren, je mehr. Ab dem nächsten Absatz jedenfalls wird – in Maßen – gespoilert.
Es passt, dass Tans bisher anspruchsvollstes Werk bei uns etwas verspätet im krummen "Kafka-Jahr" 2008 erschienen ist, einige Monate nach dem 125. Geburtstag des größten aller Literaturneurotiker. Wie Kafkas Werke drehen sich auch Tans Bücher ständig um Entfremdung und Einsamkeit, Angst und Verwirrung. Vertrautes wirkt plötzlich monströs, die Protagonisten irren durch ein System, das in sich funktioniert, von außen aber gänzlich unverständlich arbeitet.
Nun hat Shaun Tan, der im australischen Perth aufwuchs, sicher mehr Sonnentage erlebt als der Prager Kafka. Zudem erschafft Tan seine im angelsächsischen Raum längst legendären Bilderbücher auch für Kinder. Und so wirken seine Geschichten wie die optimistischeren, wenn auch niemals naiven Geschwister der klassischen Kafka-Erzählungen.
In "The Red Tree" lässt Tan ein Mädchen durch überwältigende Symbolbilder für Depressionen irren: ein chaotisches Gewoge von Dickschiffen, die deinen mickrigen Kahn zu zerschmettern drohen, ein grausiges Theater, in dem komischerweise jeder dich in der Rolle des Monsters sieht. Tans vielleicht freundlichstes Werk ist "The Lost Thing". Darin wurtschtelt sich eine Kreuzung aus Krake und Dampfmaschine, die sich von altem Christbaumschmuck ernährt, mit Hilfe eines Jungen durch eine seelenlose Konsum- und Paragraphenwelt, bis sie eher zufällig an einem geheimen Ort für andere verlorene Dinger landet. Man muss gar nicht Kafka bemühen: Wäre Philip K. Dick mit dem DDR-Sandmännchen aufgewachsen, könnte diese Story auch von ihm sein.
Das Gefühl, nicht "dazu" zu gehören, kennt Shaun Tan von Kindesbeinen an. 1974 als Sohn einer Australierin europäischer Herkunft und eines chinesischen Einwanderers geboren, sah sich Tan in der Schule plumpem Rassismus ausgesetzt. Zum Gefühl der Isolation trug bei, dass er in einem abgelegenen Vorort des ohnehin abgelegenen Perth aufwuchs, "einer der isoliertesten Städte der Welt, eingeklemmt zwischen einer gewaltigen Wüste und einem noch gewaltigeren Ozean", erinnert sich Tan auf seiner – übrigens exzellenten – Website. So entwickelte Tan früh Sympathie für die australischen Ureinwohnern: Fremde im eigenen Land. Später inspirierte die Situation der Aborigines ihn und den Autor John Marsden zu der düsteren Parabel "The Rabbits". In ihrer Bitterkeit wirkt sie wie ein Komplementärwerk zum warmherzigen "Ein neues Land".
Tans subtiler Bildroman ist, wie es der US-Comicstar und Einwandersohn Gene Yang ("American Born Chinese") auf den Punkt bringt, "nicht die Geschichte eines Immigranten, sondern die Geschichte des Immigranten". Er basiert auf Anekdoten von Tans Vater und den Erlebnisberichten anderer Einwanderer, jedoch kann die Hauptfigur für jeden stehen, der Vertrautes aufgeben muss und Neu-Land betritt.
Tans Protagonist lässt Frau und Tochter einstweilen in der düsteren Heimat zurück, um jenseits des Ozeans ein neues, besseres Zuhause zu suchen. Die neue Heimat präsentiert sich zunächst verheißungsvoll, im mächtigen Hafen reichen zwei Freiheitsstatuen sich, auf Augenhöhe miteinander, die Hände.
Doch kaum von Bord gegangen, versteht der Held die Welt nicht mehr: Sprache und Symbole sind ihm fremd, durch die Aufnahmeprozedur gelangt er mit mehr Glück als Verstand. Als er hungrig Brot zu kaufen versucht, bietet man ihm statt dessen seltsame Gemüse an: Brot ist unbekannt. Bald erkennt er auch, dass unter der leuchtenden Oberfläche gigantische, ölverschmierte Maschinen schnaufen, die Arbeiter zum Teil des Mechanismus degradieren.
Aber es gibt ein Leben jenseits des Räderwerks. Immer wieder ist der Einwanderer auf die Freundlichkeit von Fremden angewiesen, Migranten wie ihm, nun Bürger des neuen Landes, und er trifft dabei auf große Herzlichkeit. Die allerdings gründet stets in überwundenem Schrecken: Die neuen Freunde sind einst selbst Not, Versklavung oder Völkermord entkommen.
Daraus hätte nun ebenso gut gemeinter wie unerträglicher Betroffenheitskitsch werden können. Statt dessen wirkt das fremde Land auf den Leser so überraschend, fesselnd und faszinierend wie auf die Hauptfigur. Das liegt im Wesentlichen an Tans intelligentem Einsatz von Metaphern. Tan legt Wert darauf, dass seine Bilderbuch-Universen als Parallelwelten verstanden werden, die unabhängig von unserer Realität existieren, aber einer ähnlichen Logik folgen. Darin konstruiert er Beziehungen zwischen fiktiven Figuren und ihrer Umwelt, die jenen zwischen realen Menschen und deren Umgebung ähneln. Eindeutige "Sinnbilder" hingegen meidet er.
Die wundersamen Maschinen und Tiere des neuen Landes sind weit mehr als nur exotische Dekors. Sie ermöglichen es dem Leser, den Prozess der Annäherung nachzuvollziehen. Dabei geht Tan sehr geschickt und charmant vor: Kaum hat der Protagonist etwa eine Bleibe in einem riesigen Wohnblock gefunden, springt ihm aus einem Gefäß ein unheimliches Ding entgegen – ein skurriles Mischwesen aus Maus und Hai (Tan griff dabei auf die Schockbegegnung seiner Freundin mit einer Ratte zurück). Da das Geschöpf eher verspielt als gefährlich wirkt und sich ohnehin nicht vertreiben lässt, toleriert der Einwanderer es zunächst widerwillig in seiner Nähe. Später akzeptiert er es als ständigen Begleiter, der ihm bei der Kontaktaufnahme mit anderen Stadtbewohnern hilft, und gewinnt es, wie der Leser, sogar lieb.
Fast fünf Jahre hat Shaun Tan an "Ein neues Land" gearbeitet und bei aller Schwerelosigkeit der Erzählung spürt man die Überlegung und Sorgfalt in jedem einzelnen Bild. Aber ist es nun ein Comic? Vielleicht nicht. Fest steht jedoch: An Tans Buch müssen sich "echte" Comics künftig messen lassen.