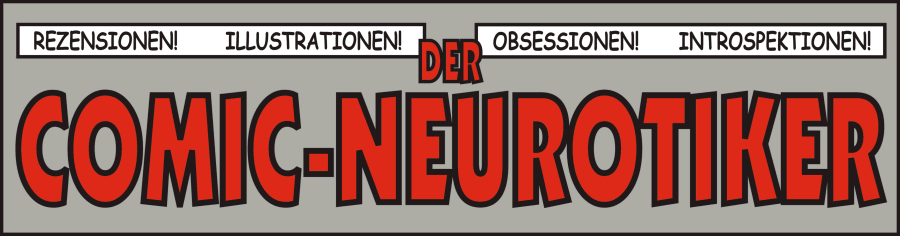[Zu Platz 2]

(© 2006 Shaun Tan;
Dt. Ausgabe: © 2008 Carlsen)
Die Begeisterung, die sein Buch international ausgelöst habe, überrasche ihn doch sehr, sagt Shaun Tan. Fern seiner Heimat Australien hat es ihm Anfang 2008 auf dem Comic-Festival von Angoulême den Preis für das Beste Album eingebracht (quasi die Goldene Palme der Comic-Welt). In Amerika öffnete es ihm die Tür zum Trickstudio Pixar, wo er Müll-Landschaften für das Robotermärchen "Wall-E" entwarf.
"Ich bin immer davon ausgegangen, dass man 'Ein neues Land' als eine Art Kuriosität betrachtet, die angesichts der unkonventionellen Form erst nach einer Weile ihr Publikum finden würde." Vielleicht übte Tan sich in seinem Interview mit dem "Comics Journal" ja in Bescheidenheit. Vielleicht sagte er auch einfach die Wahrheit. Denn "Ein neues Land", in Australien 2006 als "The Arrival" erschienen, ist sicher eine der ungewöhnlichsten Graphic Novels.
Tan setzt sich mit seinem Werk zwischen alle Stühle – und schwebt! "Ein neues Land" ist ein Bilderbuch, aber nichts für kleine Kinder. Es ist eine Utopie, die vom Gestern erzählt. Es ist Avantgarde mit nostalgischer Anmutung. Cover und Anordnung der Panels imitieren ein altes Fotoalbum, die Bilder und Bildfolgen selbst zitieren den Stummfilm, hinter dem Fotorealismus der Gesichter verbergen sich feinste Bleistiftschaffuren.
Was "Ein neues Land" vielleicht nicht ist: ein Comic. Jedenfalls nicht, wenn man Sprechblasen als unabdingbaren Teil der Definition betrachtet. Die Geschichte teilt sich gänzlich ohne Worte mit, durch Gesten und Mimik, Bildaufbau und Montage. Mitunter überlässt Tan es aber auch dem Leser, sich in einem riesigen Wimmelbild voll verwirrender Formen allein zu orientieren und so die Fremdheitserfahrung des Helden nachzuvollziehen. Gleichwohl bilden Sprache und Schrift, ihre trennende und verbindende, ihre wahrnehmungsprägende und sinnschaffende Funktion das Hauptthema des Buches. Es wimmelt nur so von Schriftzeichen – allerdings entstammen sie keiner bekannten Sprache. Sie wirken so fremd wie die Flugbusse, Kringelpflanzen und Vogelfische dieser neuen Welt.
Wie schon bei Platz 3 dieser Liste warne ich lieber vor: Wer "Ein neues Land" für sich allein entdecken will, sollte jetzt erst einmal das Buch lesen. Wie bei allen wahren Meisterwerken bereitet es auch hier bei der ersten Lektüre um so mehr Vergnügen, je weniger man weiß, und bei jeder weiteren, je mehr. Ab dem nächsten Absatz jedenfalls wird – in Maßen – gespoilert.
Es passt, dass Tans bisher anspruchsvollstes Werk bei uns etwas verspätet im krummen "Kafka-Jahr" 2008 erschienen ist, einige Monate nach dem 125. Geburtstag des größten aller Literaturneurotiker. Wie Kafkas Werke drehen sich auch Tans Bücher ständig um Entfremdung und Einsamkeit, Angst und Verwirrung. Vertrautes wirkt plötzlich monströs, die Protagonisten irren durch ein System, das in sich funktioniert, von außen aber gänzlich unverständlich arbeitet.
Nun hat Shaun Tan, der im australischen Perth aufwuchs, sicher mehr Sonnentage erlebt als der Prager Kafka. Zudem erschafft Tan seine im angelsächsischen Raum längst legendären Bilderbücher auch für Kinder. Und so wirken seine Geschichten wie die optimistischeren, wenn auch niemals naiven Geschwister der klassischen Kafka-Erzählungen.
In "The Red Tree" lässt Tan ein Mädchen durch überwältigende Symbolbilder für Depressionen irren: ein chaotisches Gewoge von Dickschiffen, die deinen mickrigen Kahn zu zerschmettern drohen, ein grausiges Theater, in dem komischerweise jeder dich in der Rolle des Monsters sieht. Tans vielleicht freundlichstes Werk ist "The Lost Thing". Darin wurtschtelt sich eine Kreuzung aus Krake und Dampfmaschine, die sich von altem Christbaumschmuck ernährt, mit Hilfe eines Jungen durch eine seelenlose Konsum- und Paragraphenwelt, bis sie eher zufällig an einem geheimen Ort für andere verlorene Dinger landet. Man muss gar nicht Kafka bemühen: Wäre Philip K. Dick mit dem DDR-Sandmännchen aufgewachsen, könnte diese Story auch von ihm sein.
Das Gefühl, nicht "dazu" zu gehören, kennt Shaun Tan von Kindesbeinen an. 1974 als Sohn einer Australierin europäischer Herkunft und eines chinesischen Einwanderers geboren, sah sich Tan in der Schule plumpem Rassismus ausgesetzt. Zum Gefühl der Isolation trug bei, dass er in einem abgelegenen Vorort des ohnehin abgelegenen Perth aufwuchs, "einer der isoliertesten Städte der Welt, eingeklemmt zwischen einer gewaltigen Wüste und einem noch gewaltigeren Ozean", erinnert sich Tan auf seiner – übrigens exzellenten – Website. So entwickelte Tan früh Sympathie für die australischen Ureinwohnern: Fremde im eigenen Land. Später inspirierte die Situation der Aborigines ihn und den Autor John Marsden zu der düsteren Parabel "The Rabbits". In ihrer Bitterkeit wirkt sie wie ein Komplementärwerk zum warmherzigen "Ein neues Land".
Tans subtiler Bildroman ist, wie es der US-Comicstar und Einwandersohn Gene Yang ("American Born Chinese") auf den Punkt bringt, "nicht die Geschichte eines Immigranten, sondern die Geschichte des Immigranten". Er basiert auf Anekdoten von Tans Vater und den Erlebnisberichten anderer Einwanderer, jedoch kann die Hauptfigur für jeden stehen, der Vertrautes aufgeben muss und Neu-Land betritt.
Tans Protagonist lässt Frau und Tochter einstweilen in der düsteren Heimat zurück, um jenseits des Ozeans ein neues, besseres Zuhause zu suchen. Die neue Heimat präsentiert sich zunächst verheißungsvoll, im mächtigen Hafen reichen zwei Freiheitsstatuen sich, auf Augenhöhe miteinander, die Hände.
Doch kaum von Bord gegangen, versteht der Held die Welt nicht mehr: Sprache und Symbole sind ihm fremd, durch die Aufnahmeprozedur gelangt er mit mehr Glück als Verstand. Als er hungrig Brot zu kaufen versucht, bietet man ihm statt dessen seltsame Gemüse an: Brot ist unbekannt. Bald erkennt er auch, dass unter der leuchtenden Oberfläche gigantische, ölverschmierte Maschinen schnaufen, die Arbeiter zum Teil des Mechanismus degradieren.
Aber es gibt ein Leben jenseits des Räderwerks. Immer wieder ist der Einwanderer auf die Freundlichkeit von Fremden angewiesen, Migranten wie ihm, nun Bürger des neuen Landes, und er trifft dabei auf große Herzlichkeit. Die allerdings gründet stets in überwundenem Schrecken: Die neuen Freunde sind einst selbst Not, Versklavung oder Völkermord entkommen.
Daraus hätte nun ebenso gut gemeinter wie unerträglicher Betroffenheitskitsch werden können. Statt dessen wirkt das fremde Land auf den Leser so überraschend, fesselnd und faszinierend wie auf die Hauptfigur. Das liegt im Wesentlichen an Tans intelligentem Einsatz von Metaphern. Tan legt Wert darauf, dass seine Bilderbuch-Universen als Parallelwelten verstanden werden, die unabhängig von unserer Realität existieren, aber einer ähnlichen Logik folgen. Darin konstruiert er Beziehungen zwischen fiktiven Figuren und ihrer Umwelt, die jenen zwischen realen Menschen und deren Umgebung ähneln. Eindeutige "Sinnbilder" hingegen meidet er.
Die wundersamen Maschinen und Tiere des neuen Landes sind weit mehr als nur exotische Dekors. Sie ermöglichen es dem Leser, den Prozess der Annäherung nachzuvollziehen. Dabei geht Tan sehr geschickt und charmant vor: Kaum hat der Protagonist etwa eine Bleibe in einem riesigen Wohnblock gefunden, springt ihm aus einem Gefäß ein unheimliches Ding entgegen – ein skurriles Mischwesen aus Maus und Hai (Tan griff dabei auf die Schockbegegnung seiner Freundin mit einer Ratte zurück). Da das Geschöpf eher verspielt als gefährlich wirkt und sich ohnehin nicht vertreiben lässt, toleriert der Einwanderer es zunächst widerwillig in seiner Nähe. Später akzeptiert er es als ständigen Begleiter, der ihm bei der Kontaktaufnahme mit anderen Stadtbewohnern hilft, und gewinnt es, wie der Leser, sogar lieb.
Fast fünf Jahre hat Shaun Tan an "Ein neues Land" gearbeitet und bei aller Schwerelosigkeit der Erzählung spürt man die Überlegung und Sorgfalt in jedem einzelnen Bild. Aber ist es nun ein Comic? Vielleicht nicht. Fest steht jedoch: An Tans Buch müssen sich "echte" Comics künftig messen lassen.
Platz 2: "Insel Bourbon 1730"
Text: Appollo, Lewis Trondheim (Dt. v. Kai Wilksen);
Grafik: Lewis Trondheim;
Verlag: Reprodukt
[Zu Platz 3]

(© 2007 Appollo – Trondheim
Dt. Ausgabe: © 2008 Reprodukt)
Die Kunst des Comics besteht bekanntlich größtenteils im Weglassen. "Insel Bourbon 1730" von Appollo und Trondheim ist ein wahres Kunstwerk des Weglassen – aber nicht nur, weil es sich um einen Comic handelt.
Weniger ist wieder mal mehr, allerdings wirkt dieses Wenige bei flüchtiger Betrachtung opulent: Auf pralle 276 Seiten (ohne den lesenswerten Anmerkungsteil) bringt es diese Geschichte, die vor dem historischen Hintergrund der realen Ergreifung und Hinrichtung des französischen Piraten Oliver Levasseur alias "La Buse" auf der ehemaligen Kolonialinsel Bourbon (heute: La Réunion) spielt. Und anders als in "Donjon" oder "Herrn Hases haarsträubende Abenteuer" zeichnet Trondheim Natur und Gebäude realistisch genug, um sie historisch-geographisch zu verorten.
Wie gewohnt lässt er aber stilisierte anthropomorphe Tierfiguren agieren, deren Minenspiel kaum jenes altgriechischer Theatermasken überbietet. Farben jenseits von Schwarz und Weiß fehlen natürlich. Als wolle er noch eins draufzusetzen, gewährt Trondheim auch den afrikanischen Charakteren keinerlei Schattierung und belässt in einigen Panels sogar den Nachthimmel weiß, in dem dann asterisk-ähnliche schwarze Sternchen funkeln. Wie passend, schließlich besteht "Insel Bourbon 1730" aus fiktionalen Fußnoten zu realer Historie.
Held des von Trondheim und dem auf Réunion geborenen, historisch versierten Co-Autor Appollo verfassten Szenarios ist der schwarzbeschopfte Enterich Raphael Pommery. Eigentlich soll er dem Chevalier Despentes von der "Akademie der Wissenschaften" in Paris bei der Suche nach dem – zu Recht – ausgestorben geglaubten Vogel Dodo (auch bekannt als Dronte) helfen. Doch weil er sich bereits auf der Anreise unrettbar im Seemannsgarn verfängt, will er sich, kaum auf der Insel angekommen, lieber den lokalen Piraten anschließen. Daraus wird nichts.
Und damit wäre die Geschichte von "Insel Bourbon 1730" auch schon erzählt. Mehr oder weniger. Wichtiger als das, was passiert, ist jedoch, was in "Insel Bourbon 1730" nicht passiert.
Das Grundkonzept ist zunächst einmal ein genialer ironischer Gag: Eine anthropomorphe Ente sucht nach einer ausgestorbenen Vogelart, kurz vor der Hinrichtung des Seeräubers La Buse, der seinerseits einen Vogelnamen trägt (La Buse = der Bussard) und als letzter großer Pirat des indischen Ozeans selbst einer aussterbenden Art angehört.
Abenteuer als Meta-Abenteuer – das erinnert natürlich an Hugo Pratt. In dessen poetisch-spröden Geschichten um Corto Maltese, "Kapitän ohne Schiff", halten sich Reflektion und Aktion aber letztlich meist die Waage, stößt der Held nach allerlei Diskussionen und Fährnissen auf des Rätsels Lösung.
"Insel Bourbon 1730" allerdings ist ein Abenteuer-Comic ohne Abenteuer: Alle Figuren suchen fortwährend danach, müssen sich aber mit Erinnerungen, Träumen und Geschichten trösten. Es ist ein Piraten-Comic ohne Piraten: die ehemaligen Korsaren sind jetzt entweder biedere Siedler (dank einer Amnestie), traurige Säufer oder im besten Fall Anführer entflohener Sklaven.
Ein echter Seeräuber immerhin ist noch da, der realhistorische La Buse, doch der sitzt im Gefängnis und wird kein einziges Mal gezeigt. Seine berühmte letzte Tat zitieren Appollo und Trondheim erst im Epilog: Auf dem Schafott warf der Pirat angeblich einen Zettel mit einer chiffrierten Nachricht in die Menge und schrie: "Mon trésor à qui saura comprendre!" – "Meinen Schatz jenem, der's versteht!"
Bis heute wurde sein Schatz nicht gehoben. Vielleicht, das deutet Protagonist Raphael im Comic an, gibt es ihn gar nicht. Vielleicht ist er eine Leerstelle, so wie La Buse selbst es bei Appollo und Trondheim bleibt. Um dieses schwarz-weiße Loch kreist die Geschichte.
Statt Geschichte zu machen, machen die Charaktere von "Insel Bourbon 1730" nur Geschichten – in jeder erdenklichen Hinsicht. Am Ende begreift Raphael das. Statt fasziniert alten Seebären zu lauschen, versteht er es nun, selbst prachtvolle Korsaren-Anekdoten aufzutischen.
Platz 3: "Drei Schatten"
Text und Grafik: Cyril Pedrosa (dt. v. Annette von der Weppen);
Verlag: Reprodukt
[Zu Platz 4]

(© 2007 Guy Delcourt Productions and Cyril Pedrosa/
Dt. Ausgabe: © 2008 Reprodukt)
Frei von Sorgen lebt der kleine Joachim mit Vater und Mutter auf einem abgelegenen Bauernhof. Ein pastorales Idyll, bis eines Abends die Silhouetten dreier Reiter am Horizont erscheinen. In den folgenden Wochen nähern sich die Schatten immer wieder dem Hof, um blitzartig zu verschwinden, wenn Joachims Eltern auftauchen. Schnell ist klar, dass sie den Sohn rauben wollen. Als alle Versuche, die Bedrohung zu vertreiben, scheitern, beschließt der Vater, mit seinem Jungen zu fliehen, bis die Reiter die Verfolgung aufgeben.
So viel zum Inhalt. Wer nun ohnehin mit dem Gedanken spielt, "Drei Schatten" zu lesen, sollte die Lektüre dieser Rezension vielleicht an dieser Stelle abbrechen und den Comic von Cyril Pedrosa ganz unvorbelastet auf sich wirken lassen. Wer aber weiterliest, möge sich anschließend bitte nicht beschweren, ich hätte ihn nicht gewarnt – obwohl ich mich bemühen werde, so wenig wie möglich zu "verraten".
Pedrosas Graphic Novel "Drei Schatten" hat ihn in Frankreich fast über Nacht zum Star gemacht – mit etwas Hilfe von Übervater Lewis Trondheim, der ihn unter seine Fittiche und ins Programm seines Labels "Shampooing" (bei Delcourt) nahm.
Pedrosa hatte zuvor mehrere Albenszenarien von David Chauvel ("Ring Circus") als Zeichner umgesetzt und das Soloprojekt "Les coeurs solitaires" verwirklicht. Doch erst die "Drei Schatten" brachten sein Erzähltalent wirklich ans Licht: ein Fantasy-Roman, ganz ohne Fantasy-Klischees, dafür voll erwachsener Angst und Trauer.
Der reißende, mitunter auch mäandernde Erzählstrom von "Drei Schatten" speist sich im Wesentlichen aus zwei Quellen: Pedrosas Mitgefühl für Freunde, die ein Kind verloren hatten, und den Einwanderer-Wurzeln des Künstlers. Deshalb will Joachims Vater mit seinem Sohn nun ins Land des Großvaters flüchten (das er selbst nicht kennt), und deshalb spricht ein greises Ehepaar, dass die beiden auf ihrer Reise treffen, nun einen von Pedrosa erfundenen portugiesischen Dialekt.
"Drei Schatten" ist keineswegs perfekt: Viel zu viele Figuren begegnen Vater und Sohn auf deren Odyssee, und während die Ambivalenz einiger Charaktere fasziniert, bleiben einige – zumindest mir – rätselhaft.
Nichtdestotrotz ist "Drei Schatten" ganz klar der bisherige künstlerische Höhepunkt jener interessanten Comic-Richtung, die ich gern "Post-Disney" nenne: Seit einigen Jahren erweitern Künstler aus dem romanischen Sprachraum, oft ehemalige Animatoren, den ursprünglich auf Kinder ausgerichteten Stil der US-Mainstream-Trickfilme, um über erwachsene Themen wie Tod, Gewalt oder Religion zu sprechen. (Vielleicht auch eine Folge der Tatsache, dass Disney nach diversen gefloppten 2-D-Trickfilmen seine europäischen Ateliers dicht gemacht und mancher Zeichner plötzlich viel Zeit hatte?). Paradebeispiele für "Post-Disney" sind die maßlos überschätzte Krimiserie "Blacksad" und die sträflich unterschätzte Glaubenssatire "Sky Doll".
Pedrosas Background als Trickfilmer zeigt sich vor allem in der "Inszenierung". Er lässt seine Figuren meisterhaft durch Gesten und Haltung schauspielern, weshalb er in vielen Szenen auf Dialoge verzichten kann. Er betont Rhythmus und Timing und kreiert dabei sogar neue Techniken. So verbindet er oft minimale Bewegungen zwischen zwei Panels (die in anderen Comics meist statisch wirken) mit "Zooms", was den Sequenzen eine verblüffende filmische Dynamik verleiht.
Pedrosas Grafik passt sich ansonsten chamäleonartig der Atmosphäre seines Szenarios an: Eben noch reitet Joachims besorgte Mutter durch ein liebevoll gezeichnetes, fast dreidimensional anmutendes Städtchen, nun türmen Vater und Sohn schon in halbtrocken aufs Papier gehuschten Pinselstrichen durch einen Wald.
Vor seiner Comic-Karriere arbeitete Cyril Pedrosa u. a. an Disneys "Hercules" und "Der Glöckner von Nôtre Dame" mit. Zwar könnte manche Figur in "Drei Schatten" optisch einem dieser Filme entsprungen sein, jedoch ist Pedrosas Strich so quecksilbrig, dass er eher Disney in seinen Stil integriert als umgekehrt.
Platz 4: "Will Eisner's The Spirit [Bd. 1]"
Text: Darwyn Cooke (dt. v. Gerlinde Althoff)
Grafik: Darwyn Cooke (pencils), J. Bone (inks), Dave Stewart (Farben)
Verlag: Panini
[Zu Platz 5]

(© 2007 DC Comics and Will Eisner Studios Inc./
Dt. Ausgabe: © 2008 Panini Comics GmbH)
Halleluja: Endlich erweckt ein Comic-Maestro Will Eisners 1940 erdachten Gangsterjäger und Frauenschwarm "The Spirit" zu neuem Leben und drückt ihm dabei seinen eigenen Stempel auf – statt nur eine weitere müde "Hommage" abzuliefern!
Sacht modernisiert, bekämpft Denny Colt alias "The Spirit" nun das Böse im 21. Jahrhundert. Dabei besitzen die neuen Storys alle Vorzüge der alten: coole Eleganz, smarten Witz und die unbändige Lust an narrativen Spielereien.
Ich spreche natürlich nicht von Frank Millers lächerlicher Kino-Adaption, die nächste Woche auch bei uns anläuft (und die ich vor einigen Wochen bei einer Preview durchleiden durfte).
Nein, die Rede ist von Darwyn Cookes im Februar 2007 gestarteter Serie "Will Eisner's The Spirit", die seit 2008 auch bei uns erscheint.
Einen Monat vor Cookes erstem regulärem "Spirit"-Heft erschien bereits das Crossover "Batman/The Spirit", an dem Cooke nur als Zeichner mitwirkte. Das Einzelheft gewann zwar einen Eisner Award, hat allerdings mit Cookes eigenen "Spirit"-Storys weder Finesse noch Charakterisierungen gemein.1
Der virtuose Nostalgiker Cooke, eine Art Wynton Marsalis der Comics, feiert in seinem "Spirit" die Tradition, modernisiert aber, wo es not tut: Aus Eisners "nicht böse gemeintem" Mohrenknaben Ebony ist ein lässiger schwarzer Teenie geworden, aus Colts naiver Flamme Ellen Dolan eine etwas spröde Internetfachfrau. Ansonsten ist es in Central City immer noch fünf nach noir.
Eisners legendäre Femmes fatales und Powerfrauen sind bei Cooke ("The New Frontier", "Catwoman: Selina's Big Score") in guten Händen: Sein aus Warner-Trickfilm-Optik und klassischer Pinup-Malerei gemixter Zeichenstil ist – jedenfalls für mich – unwiderstehlich, auch dank der schwungvollen inks von J. Bone.
Zudem sehen Cookes Ladies nicht nur klasse aus, sie haben auch Klasse. Etwa die Geheimdienst-Amazone Silk Satin, die sich über Comissioner Dolan und den blau gewandeten "Spirit" mokiert: "Bitte. Wir sind die CIA. Nicht ein paar Dorfbullen und ein Gainsborough." Und die wegen Dolans Nachfrage ("Gainsborough?") noch einen draufsetzt: "Der Blaue da. Googeln Sie mal."
Anders als Will Eisner in den 40ern läutet Cooke hier natürlich keine Revolution des sequenziellen Erzählens ein. Aber warum das Rad neu erfinden, wenn man damit so rasant zu fahren versteht und sogar atemberaubende Überschläge meistert? Ich will hier gar nicht erst von Cookes umwerfenden Noir-Schatten und -Blickwinkeln, seinem Einsatz von Sequenzpanels, Manga-Dynamik, subjektiver Perspektive und vor allem seinem stets präzisen Timing anfangen, sonst sitzen wir zwei Hübschen noch morgen hier.
Nach Heft 12 stieg Captain Cooke aus, danach kam die Serie leider vom Kurs ab. Die beiden unter des Meisters Ägide entstandenen Sammelbände erschienen letztes Jahr auch auf Deutsch, wobei Gerlinde Althoffs Übersetzung den Wortwitz des Originals recht gut einfängt. Band 1 ist der wahre Jonas, nämlich purer Cooke, im zweiten mischen schon zu viele Gastköche mit.
1) Bei uns erschien die Story als Einzelheft. In der US-Paperback-Ausgabe von Cookes "Spirit" findet man sie als Bonus in Band 1.
[Zu Platz 6]

(© 2008 Carlsen Verlag GmbH)
Beim Durchblättern sieht erst einmal alles sensationell aus: 244 Seiten voll detailreicher Bleistiftzeichnungen, in denen das Tokio des Jahres 1941 wiederaufersteht, wimmelnde Panoramapanels und einige schöne Montagen – großes Kino auf Papier! Beginnt man dann aber zu lesen, bemerkt man die Probleme: Gesichter wirken maskenhaft, Gesten steif. Und dann diese gezeichneten Zeitzeugen, die sich zwischendurch in "Interview"-Bröckchen zu Wort melden – vade retro, Guido Knopp!
Und dann liest man "Die Sache mit Sorge" zu Ende und stellt überrascht fest, dass einige dieser Schwächen Stärken sind und dass Isabel Kreitz wohl der beste deutsche Comic 2008 gelungen ist.
Anders als der Untertitel "Stalins Spion in Tokio" vermuten lässt, konzentriert sich Kreitz nämlich keineswegs auf den Journalisten Richard Sorge, der Moskau 1941 vor Hitlers geplantem Überfall auf die UdSSR warnte, auf Unglauben stieß und nach seiner Enttarnung von den Russen fallen gelassen und von den Japanern hingerichtet wurde. Nein, die Thomas-Mann-Verehrerin Kreitz (ihr "Buddenbrooks"-Comic scheiterte bislang am Dünkel des Vorlagenverlages) erforscht die Luxus-Enklave der deutschen Botschaft in Tokio und zeichnet sie als eine Art Nazi-"Zauberberg". Dessen hell- bis dunkelbraune Herren befassen sich – fern von Berlin – lieber mit Klatsch und Konzerten als mit Krieg und Politik. Als Spötter und Spion irrlichtert Richard Sorge am Rande dieser Welt herum. Seiner Romanze mit der zur Botschafts-Menagerie gehörigen Musikerin Eta Harich-Schneider räumt Kreitz dabei ebenso viel Raum ein wie seiner Agententätigkeit.
Kreitz' Hirohito-Tokio und all seine Bewohner wirken auf den ersten Blick fast fotorealistisch, stecken aber voll fiebrig flirrender Schraffuren – so wie Historie großenteils aus trügerischen Erinnerungen besteht. Ebenso fügt sich aus den Schilderungen der Zeitzeugen bis zuletzt kein klares Bild des Reporters, Idealisten, Säufers und Schürzenjägers Richard Sorge zusammen: Jeder Beteiligte erzählt nur seine Geschichte.
In Szenario wie Grafik zwingt Kreitz den Leser zur Distanz. So gelingt ihr nicht nur ein subtiles Zeit- und Milieuporträt, sondern auch ein intelligenter Gegenentwurf zum History-Infotainment Knopp'scher Prägung.