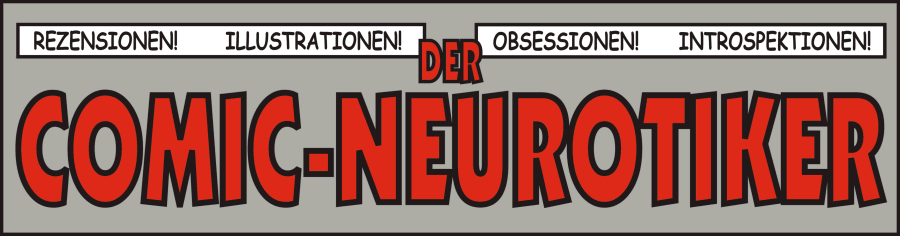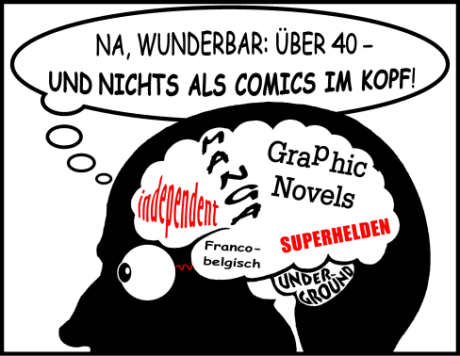
Im Labyrinth der Fantasy-Serie "Donjon"
(Teil 2 von 2)

Killerin Alexandra sucht Trost bei Professor Cormor.
Aus: "Donjon -84: Nach dem Regen"
(© 2006 by Guy Delcourt Productions;
dt. Ausg.: © 2007 Reprodukt)
Wenn Joann Sfar und Lewis Trondheim viermal gefragt werden, wie ihre "Donjon"-Geschichten entstehen, geben sie vier unterschiedliche Antworten. Doch, so viel scheint sicher, offenbar ist es meistens Sfar, der die Grundidee eines neuen Albums liefert. In langen Telefongesprächen spinnen beide Autoren dann das Szenario aus. Beim eigentlichen Schreiben folgen sie keiner festen Arbeitsteilung: Mal liefert Sfar mehrseitige Zusammenfassungen, die Trondheim nur im Detail verändert, mal arbeiten sie sich abwechselnd Seite für Seite durch das Album, so dass auf eine reine Sfar-Seite eine Seite purer Trondheim folgen kann. Der französische "Donjon"-Verleger Guy Delcourt, verrät Sfar in einem "BD Paradiso"-Interview, "foppt uns manchmal ein bisschen, indem er sagt, Lewis wäre Fred Astaire und ich Ginger Rogers." Grundsätzlich skizziert Trondheim nach dem Erstellen des Szenarios Seitenlayout und Bildaufbau – selbst dann, wenn nicht er oder Sfar, sondern einer ihrer zahlreichen Gastkünstler das Album zeichnet.
"Donjon", meint Trondheim, sei inzwischen "ein Monster geworden, ein sympathisches Monster, aber eines, dass niemals einer allein hätte erschaffen können." Als er und Sfar neben der Urserie "Donjon" (alias "Donjon Zenit") Serien über Vorgeschichte ("Donjon Morgengrauen") und Untergang ("Donjon Abenddämmerung") ihrer Fantasy-Festung starteten, deuteten sie durch die eigenwillige Nummerierung der Alben an, dass die gesamte Geschichte 300 Alben umfassen würde (dazu später mehr). Auf Nachfragen, ob sie dass denn ernst meinten, "sagten wir zunächst immer nein", erzählt Trondheim auf "BD Paradiso", "aber inzwischen denken wir: warum nicht?" In erster Linie ginge es den Autoren jedoch einfach darum, Spaß zu haben.
"Donjon" liegt kein bis ins letzte Detail durchdachtes Konzept zu Grunde. Sfar und Trondheim kreierten die Serie Ende der 90er-Jahre aus Lust und Laune. Oder besser: aus Frust und Laune. Denn bevor es "Donjon" gab, gab es "Troll" [...].
Im Labyrinth der Fantasy-Serie "Donjon"
(Teil 1 von 2)
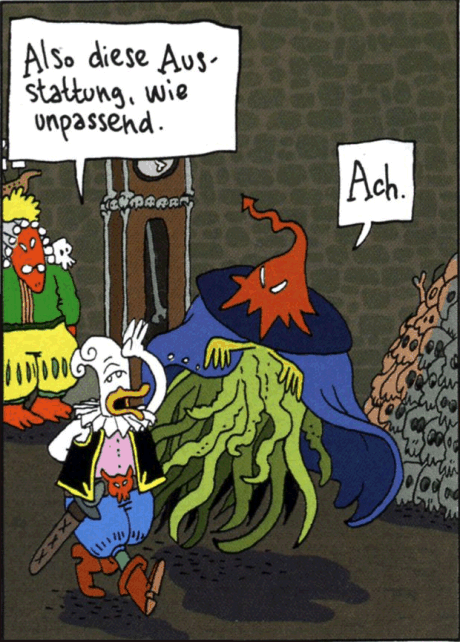
Als Innenarchitekt verkleidet,
infiltriert Herbert das Hauptquartier des Feindes.
Aus: "Donjon 1: Das Herz einer Ente".
(© 1998 by Guy Delcourts Productions;
dt. Ausg.: © 2007 Reprodukt)
Obwohl frankophile deutsche Comic-Fans es gern leugnen, verkauft sich auch im Comic-Wunderland Frankreich pubertärer Trash wesentlich besser als intellektuelle Panel-Kunst. Besonders die Unmengen einheimischer "héroïc-fantasy"-Alben, mit langen Schwertern und knappen Lederminis, haben mich beim Besuch französischer Comic-Läden immer wieder erstaunt.
Bevor ich mir hier unnötig böse Kommentare einhandle: Auch ich mag den überbordenden Einfallsreichtum und rüden Humor des "Lanfeust"-Comic-Kosmos, und "Auf der Suche nach dem Vogel der Zeit" gehört meines Erachtens in jede gute Sammlung. Die einzige französische Fantasy-Serie aber, deren Komplexität, Intelligenz und Esprit mich immer wieder beeindruckt, ist ausgerechnet eine Persiflage.
Fast zehn Jahre hat sie inzwischen auf dem Buckel und noch immer wirkt ihre Eröffnungsszene wunderbar frisch und frech:
"Vier schwarze Türme, deren höchster von zehn Tagesmärschen Entfernung aus zu sehen ist. Eine versteckte Eisentür inmitten der stinkenden Sümpfe. Endlose, mit Moos und Salpeter bedeckte Gänge. Leitern, Lastenaufzüge, Treppen bis ins Innere der Erde. Hinter jedem Stein verbergen sich legendäre Waffen, Fallen [...] [und] Monster zu Hunderten. Aus der ganzen Welt kommen Abenteurer auf der Suche nach Reichtum und Erfahrung, um sich an meinen Monstern zu messen. [...]Sekunden nach dieser gescheiterten feindlichen Übernahme lässt der Hüter der Donjon-Festung die unverschämten Kapuzenträger aus dem Fenster des höchsten Turmes werfen.
Und ihr mit euren Sockenköpfen, ihr kommt einfach her und verlangt, dass ich meinen Donjon verkaufe!
Ihr spinnt wohl!"
Joann Sfar und Lewis Trondheim brauchten 1998 keine drei Seiten, um deutlich zu machen, dass in ihrer Serie "Donjon" ein anderer Ton herrschte als im großen Rest der Fantasy: respektlos, aber sophisticated, traditionsbewusst, aber sehr heutig.
über die "Königin der Herzen" schreiben würde, aber...
Zwei "Altmeister des Comics" ("Bild" zitiert die "FAZ" als Leumund) seien hier kreativ gewesen, die Namen erfährt man aber erst auf der letzten Seite, wo sich auch das Werk selbst findet: "Sid Jacobson (77) und Ernie Colón (75)" – bitte, wer? Erst beim Verweis auf deren kürzliche Comic-Umsetzung des "9/11 Report" klingelt es.
Ebenso wie bei der von viel Hype begleiteten, umstrittenen grafischen Adaption des Terror-Berichts ("Bild": "mit Sprechblasen und einem einstürzenden World Trade Center als Buntbild") frage ich mich auch bei dem exklusiv für Springer kreierten Diana-Comic: Was soll das Ganze?
Stärker noch als "The 9/11 Report" (im Original bei Marvel, deutsch bei Panini) ist auch "Dianas letzte Stunden" nur im weitesten Sinne ein Comic. Im Grunde handelt es sich um eine mit gezeichneten Momentaufnahmen illustrierte Text-Chronik, in der man nicht einmal Sprechblasen findet, geschweige denn avanciertere Techniken des sequenziellen Erzählens.
Dass die Tragödie betont nüchtern nachgezeichnet ist, macht die Umsetzung keineswegs tiefgründiger. Sid Jacobson betrachtet das als "grafischen Journalismus", doch wer den erleben will, sollte eher zu Art Spiegelmans "Maus", Joe Saccos "Safe Area Gorazde" oder Guy Delisles "Shenzhen" greifen.
Wer sich selbst eine Meinung bilden möchte: Den Comic gibt es auch online.
(Bizarrerie am Rande: Obwohl das erste Panel Diana und Dodi al-Fayed im Motorboot zeigt, plappert der "Bild"-Begleittext auf der Titelseite von einem "offenen Cabrio"! In der Online-Version desselben Textes wurde der Fehler korrigiert.)
"Astro City: Der gefallene Engel"
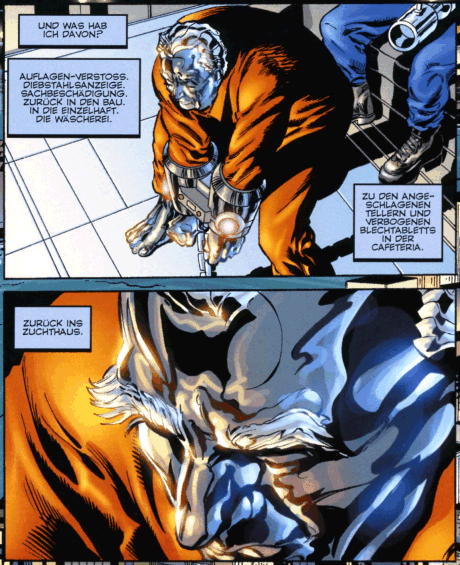
Metallermüdung: Steeljack hat die Pechvogelrolle satt
(© 2000 Juke Box Productions;
dt. Ausg.: © 2007 Panini Verlag-GmbH)
Herrschaften, selten hat es mir so viel Spaß gemacht, nach Jahren wieder in eine Serie einzusteigen! Auch wenn im Superhelden-Comic wohl mehr Quatsch produziert wird als in jedem anderen Genre, liefern einige helle Köpfe ab und an kleine Meisterwerke ab. Etwa Kurt Busiek in seiner 1995 gestarteten Serie "Astro City" – mit der ich, zugegeben, in ihren frühen Jahren wenig anfangen konnte.
In den USA werden die Stories über eine Stadt, in der seit dem 19. Jahrhundert Superhelden- und -schurken zum Alltag gehören, immer wieder als Rettung des Genres gefeiert. Im deutschsprachigen Raum jedoch konnte "Astro City" kaum Fans erobern, seit der Verlag Thomas Tilsner ("Speed Comics") 1999 mit der Übersetzung begann. Dort erschienen immerhin die ersten 13 Episoden, aufgeteilt in neun deutsche Hefte, 2001 allerdings wurde die Serie bei uns schon wieder eingestellt.
Mit der Graphic Novel "Der gefallene Engel" setzt Panini die deutsche Ausgabe nun fort, und zwar – wenn man das nach sechs Jahren Pause so nennen darf – nahtlos: Nach den 13 Tilsner-Bänden umfasst die in sich abgeschlossene "Engel"-Storyline nun Heft 14 bis 20.
Mea culpa: Ich bin seinerzeit schon nach dem ersten amerikanischen Sammelband ausgestiegen. Klar, die Stories in "Life in the Big City" waren pfiffig, aber Busieks anfangs zwischen Pathos und Ironie schlingernder Schreibstil und die betont episodische Struktur des ersten Buchs konnten mich nicht fesseln.
Doch nun kommt Carl Donewicz alias "the Steeljacketed Man" oder einfach "Steeljack": 800 Pfund lebender Stahl, eine wandelnde Metallskulptur, die aussieht wie Robert Mitchum in seinen 50ern und redet wie Sylvester Stallone in seinen wenigen guten Filmen: "Das erste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich wegwollte", beschreibt Steeljack seine Jugend. Doch als er nach Jahrzehnten im Knast zurückkehrt nach Kiefer Square, das Hell's Kitchen von Astro City, erkennt er: "Hier ist es gemütlich wie in alten Schuhen". Busiek gelingen herrlich lakonische Off-Kommentare, die auch in der Übersetzung klasse klingen.Selbst wenn Steeljack am Ende seiner Weisheit ist, was bei ihm ziemlich schnell geht, fällt ihm immer noch ein: "Dazu hab ich nichts zu sagen. Also sag ich nichts."
Das Problem mit "aspekte" ist, dass die Macher es als populäres Magazin über komplexe Kulturthemen verstanden wissen möchten, diesem Anspruch aber zu selten gerecht werden. Mit einer Mischung aus Höhere-Töchter-Snobismus und gekünstelter Lockerheit wird dem Zuschauer dort Kultur in Form von Tipps und Schlaglichtern präsentiert. Wer sich auf dem jeweiligen Terrain aber ein bisschen auskennt, merkt schnell, dass die Autoren der Beiträge mitunter herzlich wenig Ahnung vom Thema haben.
Ein gutes Beispiel ist Achim Zeilmanns gestriger Beitrag (17. August 2007) über Robert Löhrs neuen Roman "Das Erlkönig-Manöver". Löhr hatte zuvor mit "Der Schachautomat" einen bei Publikum wie Kritikern erfolgreichen historischen Roman über den angeblichen Schachroboter von Wolfgang von Kempelen veröffentlicht. Im "Erlkönig-Manöver" schickt er nun Goethe, Schiller, Alexander von Humboldt, Bettina von Arnim (das Fünf-Mark-Schein-Schnuckelchen) und eine Handvoll weiterer deutscher Dichter und Denker auf eine geheime Mission: Die Geistesgrößen sollen Napoleon stürzen.
Jeder Comic- oder Kino-Freund hat jetzt bestimmt schon dreimal "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen!" gerufen: 1999 von Alan Moore als Comic-Serie erdacht, 2003 von Stephen Norrington schlecht verfilmt. Für Nichteingeweihte, z. B. "aspekte"-Mitarbeiter, hier noch mal kurz die Story: Allan Quatermain, Kapitän Nemo, Dr. Jekyll, Mina Harker (aus "Dracula") und weitere Charaktere der Unterhaltungsliteratur müssen das britische Empire retten.
Von fiktiven Figuren der viktorianischen Ära ist es nur ein kleiner Schritt zu realen Größen der deutschen Klassik und Romantik. Aber, hey, das Konzept von Löhrs Roman klingt trotzdem witzig und spannend. Schön wäre es allerdings gewesen, wenn man beim ZDF in einem Nebensatz auf die geistige Nähe zu Moores Comic hingewiesen hätte. Zumal Löhr im Interview sogar darauf anspielt: "Vor allen Dingen hat das noch keiner gemacht: derart respektlos mit diesen Biografien umzuspringen und sie in dieser Liga der außergewöhnlichen Klassiker zusammenzufassen".
Beim ZDF hat man jedoch offenbar weder von Comic noch Film gehört. Da verwundert es dann erst recht nicht, dass niemand Herrn Löhr darauf hinweist, dass er auch in Deutschland längst einen Vorgänger hat: Der Autor Kai Meyer ließ die Brüder Grimm bereits 1995 und 1997 in seinen Horror-Krimis "Der Geisterseher" und "Die Winterprinzessin" als Detektive ermitteln.
Übrigens: Auf der – durchaus gut designten – "aspekte"-Website gibt es den Beitrag als Text und Video.