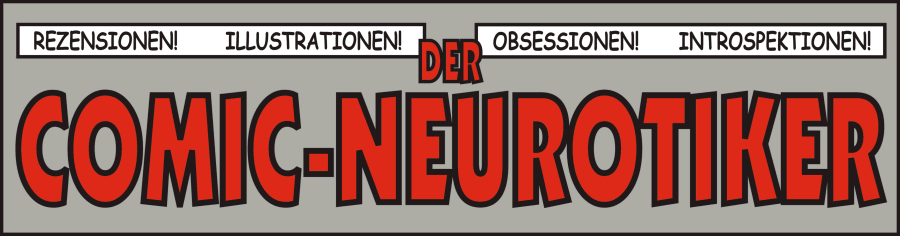Dienstag, 15. Mai 2007
Mutanten-Musical
Warum "Spider-Man 3" gar nicht so schlecht ist
Warum "Spider-Man 3" gar nicht so schlecht ist
neurokomiker, 12:01h
Okay, ich geb's zu: Ich habe mich bei "Spider-Man 3" blendend amüsiert. Damit gehöre ich zu einer Minderheit (hey, das wollte ich schon immer mal ausprobieren!), denn Sam Raimis Film schlägt in Internet und Presse mehr Feindseligkeit entgegen als dem nun wirklich misslungenen "X-Men – Der letzte Widerstand". Das wurmt mich, denn trotz seines Riesenbudgets (angeblich 258 Mio. Dollar) ist "Spider-Man" immer noch weit von herzlosem Kommerz entfernt. Deshalb gestatte man mir, auch wenn seit dem deutschen Kinostart schon 15 Tage verstrichen sind, ein kleines Plädoyer.
Zunächst einmal: Nach dem unvollkommenen, aber sympathischen ersten Teil und der fast makellosen Fortsetzung ist "Spider-Man 3" tatsächlich eine Enttäuschung. "Spideys" Probleme ergeben sich diesmal im doppelten Sinne aus dem Bemühen der Autoren (darunter Regisseur Sam Raimi und sein Bruder Ivan), Themen des ersten Teils in einer dramaturgischen Klammer zum Abschluss zu bringen. Einem Abschluss, der, wie bei Fortsetzungen üblich, bitteschön noch einmal mehr Schmackes haben soll als die Vorgänger. Das sieht dann so aus: Durch die Verschmelzung mit einem außerirdischen Gelee-Geschöpf, entwickelt sich der Student Peter Parker alias Spider-Man (Tobey Maguire) zum aggressiven Super-Macho. Als er mit Kommilitonin Gwen Stacy (Bryce Dallas Howard) anbändelt, vergrätzt er Freundin Mary Jane (Kirsten Dunst). Die sucht Zuflucht bei Peters Ex-Busenfreund Harry Osborn. Als Sohn des "Grünen Kobolds", eines verstorbenen Superschurken, hat der selbst noch ein Hühnchen mit Spider-Man zu rupfen. Kaum hat sich Peter Parker des anhänglichen Aliens entledigt, verwandelt das Glibberwesen den Fotoreporter Eddie Brock (Topher Grace) ins spitzzahnige Monster Venom. Und das verbündet sich prompt mit dem kristallinen Kriminellen "Sandman" (grandios als trauriger Grobian: Thomas Haden Church) gegen Spidey.
Puh, weniger wäre wirklich mehr gewesen. Die Figur des Venom erscheint zu spät und erhält zu wenig Raum, die talentierte Bryce Dallas Howard (der einzige Grund, sich "The Village" anzuschauen) hat als Gwen Stacy kaum mehr zu tun, als Peter Parker anzuhimmeln. Und dann ist da noch dieser ominöse greise Butler der Osborn-Familie. Der hat sich in Teil 1 und 2 ziemlich gut versteckt gehalten, agierte aber angeblich ständig im Hintergund und führt nun sogar eine entscheidende Wendung herbei. Da kommt sich noch der gutmütigste Zuschauer verschaukelt vor.
Doch dann sind da wieder Szenen, in denen Sam Raimi zeigt, welche magischen Momente im Superheldenkino möglich sind – und nur dort. Die Geburt des Schurken Sandman, einer Art Sandsturm in Menschengestalt, ist vielleicht das anrührendste und poetischste Exempel digitaler Tricktechnik, das man bis dato im Kino gesehen hat. Der Sandman ist einer der Lieblingsschurken von Sam Raimi, und man spürt es.
"Spider-Man 3" verfügt über Schwächen und Stärken, die die Reihe seit deren Beginn begleiten. Nach wie vor gibt es keine starke Frauenfigur. Selbst ein so müder Kinoheld wie Daredevil hat seine Elektra, Spider-Man hat Sandkastenliebe Mary Jane und Tantchen May. Ein reines Vergnügen freilich sind wie immer die Auftritte von J. K Simmons als cholerischer Blattmacher J. Jonah Jameson, ebenso die obligatorische Gastrolle von Raimi-Kumpan Bruce Campbell ("Army of Darkness"), diesmal als französischer Oberkellner. Außerdem beweist Raimi seit – dem tricktechnisch noch durchwachsenen – Teil 1 ein Gespür dafür, wie Superhelden-Action aussehen sollte. Wenn Peter Parker seine Kräfte einsetzt, dann wirkt das deutlich lustvoller als bei chronisch schlecht gelaunten Kollegen wie Batman, Hulk oder den X-Men. Die Actionszenen sind diesmal nicht so gut in die Handlung integriert wie in "Spider-Man 2", trotzdem bieten die furios kinetischen, wuchtigen Bilder wunderbar überdimensionalen Krawall.
Sam Raimi, so scheint es, hat erkannt, dass die Vorfahren der klassischen Marvel-Superheldenstories nicht nur Mythologie, Science-Fiction und Detektivgeschichte sind, sondern dass auch Teenagerschnulze und Musical zur Familie gehören. Drum mutiert Peter Parker unter dem Einfluss des bösen Aliens nicht etwa zum Monster, sondern zu einem Möchtegern-Gigolo, der unter den verwunderten Blicken von New Yorker Schönheiten selbstverliebt durch die Straßen tänzelt. Raimi entlarvt die Marvel-Helden als Operettenpersonal: ewige Teenager, die sich an bunten Kostümen freuen, jedes Gefühl gleich für ein großes halten und dennoch vor dem ernsten Alltag in Träume und Gekicher flüchten. Es wird verblüffend viel getanzt, gesungen und musiziert in "Spider-Man 3". Der Film beginnt mit Mary Janes Musicaldebüt am Broadway, später geht der besessene Peter Parker im Jazzschuppen an die Decke, und schließlich findet er durch sakrale Klänge wieder zu sich selbst.
Welch ein Jammer, dass "Nightmare Before Christmas"- Komponist Danny Elfman sich nach zwei "Spider-Man"-Filmen mit Regisseur Raimi zerstritten und die Arbeit am Soundtrack dem bestenfalls passablen Christopher Young ("Ghost Rider") überlassen hat. Andernfalls hätte sich dieses auf bekannte Nummern wie Peggy Lees "Fever" und den Monroe-Klassiker "I'm Through with Love" zurückgreifende Mutanten-Musical vielleicht zur versponnenen Oper entwickelt. So aber gerät "Spider-Man 3" manchmal zum Kino-Äquivalent einer Oldie-Show, nicht nur wenn Harry und Mary Jane in der Küche twisten.
Die Nostalgie sitzt Spider-Man fester im Genick als sein außerirdischer Symbiont. Anfang der 60er schien es revolutionär, als der Marvel-Comic-Szenarist Stan Lee seine Stories um Spider-Man & Co. nicht in fiktiven Großstädten namens Metropolis oder Gotham ansiedelte (dem Zuhause von Superman respektive Batman), sondern mitten in New York. Dieser schrecklich schöne, schön schreckliche "Big Apple" des Marvel-Universums war natürlich niemals ein Abbild der Realität und ist es heute noch sehr viel weniger. Wer unbedingt will, mag wie Daniel Haas bei "Spiegel Online", die zerstörten Hochhäuser und die Sand(man)schlachten als Verweis auf den 11. September 2001 und Amerikas Scheitern im Irak interpretieren (übrigens eine der wenigen positiven Kritiken). Letztlich wirkt das New York von "Spider-Man" aber mit jedem Film mehr wie ein Ort, an dem die frühen Sixties niemals enden. Eine Wolkenkratzerfantasie voll rasender Reporter, unschuldiger Debütantinnen und sentimentaler Gangster.
Allerdings: Dieses Comic-New-York ist nicht mehr und nicht weniger als ein amerikanischer Erinnerungsort, ein fiktiver Referenzpunkt im kulturellen Gedächtnis – nicht nur der US-Bürger. Weil Raimis Filme über Spider-Man stets auch Filme über dessen urbanes Netz sind, wirken sie größer und mächtiger, aber auch menschlicher als die meisten anderen Superheldenfilme. Das gilt, bei aller berechtigten Kritik, auch für Teil 3. Mag die Story auch überladen dahinholpern und -schlingern: Raimi bietet wieder einmal großartigen Eskapismus – nicht nur eine Flucht ins Abenteuer, sondern die Flucht in eine ganze abenteuerliche Stadt.
Zunächst einmal: Nach dem unvollkommenen, aber sympathischen ersten Teil und der fast makellosen Fortsetzung ist "Spider-Man 3" tatsächlich eine Enttäuschung. "Spideys" Probleme ergeben sich diesmal im doppelten Sinne aus dem Bemühen der Autoren (darunter Regisseur Sam Raimi und sein Bruder Ivan), Themen des ersten Teils in einer dramaturgischen Klammer zum Abschluss zu bringen. Einem Abschluss, der, wie bei Fortsetzungen üblich, bitteschön noch einmal mehr Schmackes haben soll als die Vorgänger. Das sieht dann so aus: Durch die Verschmelzung mit einem außerirdischen Gelee-Geschöpf, entwickelt sich der Student Peter Parker alias Spider-Man (Tobey Maguire) zum aggressiven Super-Macho. Als er mit Kommilitonin Gwen Stacy (Bryce Dallas Howard) anbändelt, vergrätzt er Freundin Mary Jane (Kirsten Dunst). Die sucht Zuflucht bei Peters Ex-Busenfreund Harry Osborn. Als Sohn des "Grünen Kobolds", eines verstorbenen Superschurken, hat der selbst noch ein Hühnchen mit Spider-Man zu rupfen. Kaum hat sich Peter Parker des anhänglichen Aliens entledigt, verwandelt das Glibberwesen den Fotoreporter Eddie Brock (Topher Grace) ins spitzzahnige Monster Venom. Und das verbündet sich prompt mit dem kristallinen Kriminellen "Sandman" (grandios als trauriger Grobian: Thomas Haden Church) gegen Spidey.
Puh, weniger wäre wirklich mehr gewesen. Die Figur des Venom erscheint zu spät und erhält zu wenig Raum, die talentierte Bryce Dallas Howard (der einzige Grund, sich "The Village" anzuschauen) hat als Gwen Stacy kaum mehr zu tun, als Peter Parker anzuhimmeln. Und dann ist da noch dieser ominöse greise Butler der Osborn-Familie. Der hat sich in Teil 1 und 2 ziemlich gut versteckt gehalten, agierte aber angeblich ständig im Hintergund und führt nun sogar eine entscheidende Wendung herbei. Da kommt sich noch der gutmütigste Zuschauer verschaukelt vor.
Doch dann sind da wieder Szenen, in denen Sam Raimi zeigt, welche magischen Momente im Superheldenkino möglich sind – und nur dort. Die Geburt des Schurken Sandman, einer Art Sandsturm in Menschengestalt, ist vielleicht das anrührendste und poetischste Exempel digitaler Tricktechnik, das man bis dato im Kino gesehen hat. Der Sandman ist einer der Lieblingsschurken von Sam Raimi, und man spürt es.
"Spider-Man 3" verfügt über Schwächen und Stärken, die die Reihe seit deren Beginn begleiten. Nach wie vor gibt es keine starke Frauenfigur. Selbst ein so müder Kinoheld wie Daredevil hat seine Elektra, Spider-Man hat Sandkastenliebe Mary Jane und Tantchen May. Ein reines Vergnügen freilich sind wie immer die Auftritte von J. K Simmons als cholerischer Blattmacher J. Jonah Jameson, ebenso die obligatorische Gastrolle von Raimi-Kumpan Bruce Campbell ("Army of Darkness"), diesmal als französischer Oberkellner. Außerdem beweist Raimi seit – dem tricktechnisch noch durchwachsenen – Teil 1 ein Gespür dafür, wie Superhelden-Action aussehen sollte. Wenn Peter Parker seine Kräfte einsetzt, dann wirkt das deutlich lustvoller als bei chronisch schlecht gelaunten Kollegen wie Batman, Hulk oder den X-Men. Die Actionszenen sind diesmal nicht so gut in die Handlung integriert wie in "Spider-Man 2", trotzdem bieten die furios kinetischen, wuchtigen Bilder wunderbar überdimensionalen Krawall.
Sam Raimi, so scheint es, hat erkannt, dass die Vorfahren der klassischen Marvel-Superheldenstories nicht nur Mythologie, Science-Fiction und Detektivgeschichte sind, sondern dass auch Teenagerschnulze und Musical zur Familie gehören. Drum mutiert Peter Parker unter dem Einfluss des bösen Aliens nicht etwa zum Monster, sondern zu einem Möchtegern-Gigolo, der unter den verwunderten Blicken von New Yorker Schönheiten selbstverliebt durch die Straßen tänzelt. Raimi entlarvt die Marvel-Helden als Operettenpersonal: ewige Teenager, die sich an bunten Kostümen freuen, jedes Gefühl gleich für ein großes halten und dennoch vor dem ernsten Alltag in Träume und Gekicher flüchten. Es wird verblüffend viel getanzt, gesungen und musiziert in "Spider-Man 3". Der Film beginnt mit Mary Janes Musicaldebüt am Broadway, später geht der besessene Peter Parker im Jazzschuppen an die Decke, und schließlich findet er durch sakrale Klänge wieder zu sich selbst.
Welch ein Jammer, dass "Nightmare Before Christmas"- Komponist Danny Elfman sich nach zwei "Spider-Man"-Filmen mit Regisseur Raimi zerstritten und die Arbeit am Soundtrack dem bestenfalls passablen Christopher Young ("Ghost Rider") überlassen hat. Andernfalls hätte sich dieses auf bekannte Nummern wie Peggy Lees "Fever" und den Monroe-Klassiker "I'm Through with Love" zurückgreifende Mutanten-Musical vielleicht zur versponnenen Oper entwickelt. So aber gerät "Spider-Man 3" manchmal zum Kino-Äquivalent einer Oldie-Show, nicht nur wenn Harry und Mary Jane in der Küche twisten.
Die Nostalgie sitzt Spider-Man fester im Genick als sein außerirdischer Symbiont. Anfang der 60er schien es revolutionär, als der Marvel-Comic-Szenarist Stan Lee seine Stories um Spider-Man & Co. nicht in fiktiven Großstädten namens Metropolis oder Gotham ansiedelte (dem Zuhause von Superman respektive Batman), sondern mitten in New York. Dieser schrecklich schöne, schön schreckliche "Big Apple" des Marvel-Universums war natürlich niemals ein Abbild der Realität und ist es heute noch sehr viel weniger. Wer unbedingt will, mag wie Daniel Haas bei "Spiegel Online", die zerstörten Hochhäuser und die Sand(man)schlachten als Verweis auf den 11. September 2001 und Amerikas Scheitern im Irak interpretieren (übrigens eine der wenigen positiven Kritiken). Letztlich wirkt das New York von "Spider-Man" aber mit jedem Film mehr wie ein Ort, an dem die frühen Sixties niemals enden. Eine Wolkenkratzerfantasie voll rasender Reporter, unschuldiger Debütantinnen und sentimentaler Gangster.
Allerdings: Dieses Comic-New-York ist nicht mehr und nicht weniger als ein amerikanischer Erinnerungsort, ein fiktiver Referenzpunkt im kulturellen Gedächtnis – nicht nur der US-Bürger. Weil Raimis Filme über Spider-Man stets auch Filme über dessen urbanes Netz sind, wirken sie größer und mächtiger, aber auch menschlicher als die meisten anderen Superheldenfilme. Das gilt, bei aller berechtigten Kritik, auch für Teil 3. Mag die Story auch überladen dahinholpern und -schlingern: Raimi bietet wieder einmal großartigen Eskapismus – nicht nur eine Flucht ins Abenteuer, sondern die Flucht in eine ganze abenteuerliche Stadt.